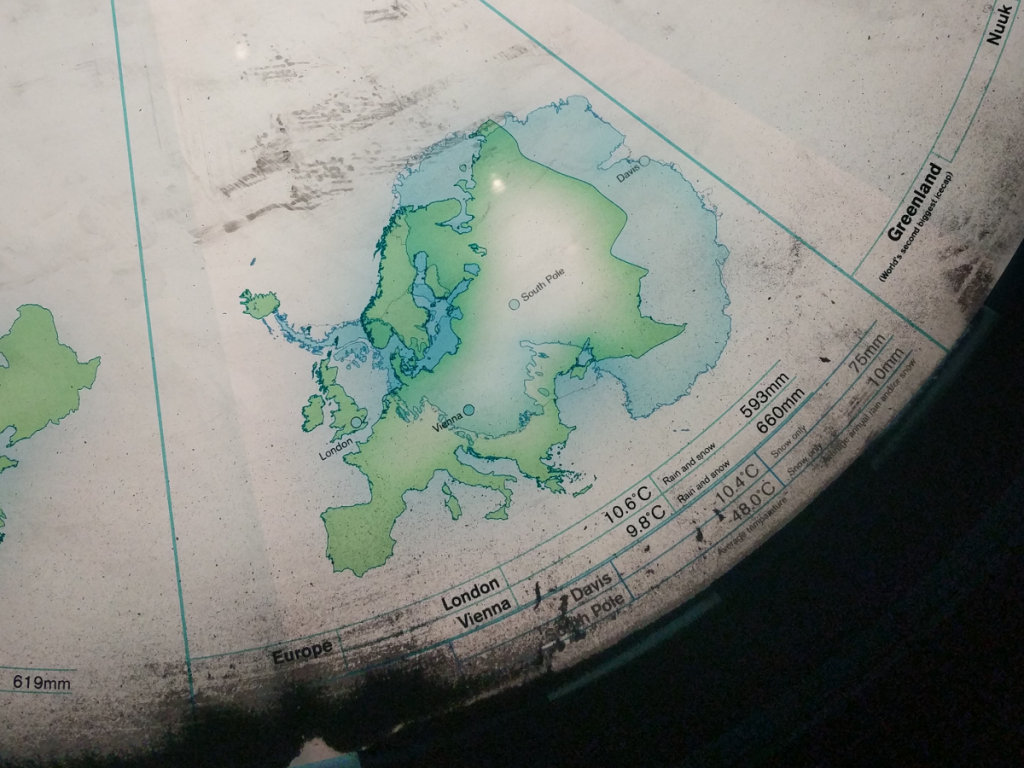Nach dem Museum war ich abends kurz einmal in einer Bar in der Nachbarschaft vorbeischauen. Weil immerhin, am Tresen sitzen und den einen Leuten beim Arbeiten und den anderen beim Entspannen zuschauen, da hab ich gewissermaßen eine Routine darin. Ich hab mir gedacht, die Barkultur in Sydney, da sollte ich rein aus touristischen Gründen einen Blick hineinwerfen. Hat mich auch Überwindung gekostet letztendlich, dass ich mich dazu aufgerafft hab. Ich glaub ich hab dem Barkeeper dann gleich einen falschen Eindruck gemacht, weil ich irgendwie gemeint hab, ich mach das nicht so oft, dass ich mir eine Manhattenvariation hinstellen lasse, aber das war wirklich nur gemeint, ich hab schon lange keinen Drink in dem Sinn gehabt. Er aber, aufmerksam, dass sich hier ein Mann allein an die Bar setzt hochprozentiges ins Glas bestellt, hat mich gleich gefragt was meine Geschichte sei. Nein, nein, hab ich gemeint, das auch wieder nicht und gleich einmal einen Felgeaufschwung auf die Metaebenegemacht, als ich gesagt hab, dass das schon ein guter Job ist, das Barkeepen, weil man in wenigen anderen Berufen dazu kommt, dem Gegenüber mit diesem Satz zu kommen: Was die Geschichte sei. Und es ist ein guter Satz. Wie ich s gesagt hab, hab ich mir gedacht, dass natürlich eine qualitativ arbeitende SozialwissenschaftlerIn durchaus auch einmal in die Situation kommt, die Person gegenüber zu fragen, was ihre Geschichte sei. Insgesamt steckt man vielleicht mehr Aufwand in die Gestaltung des Leitfadens. Aber vielleicht haben Leute in ihre BarkeeperIn mehr Vertrauen als in die Person mit dem Aufnahmegerät und der Einverständniserklärung.
Oh, ich hab mich dann gleich noch ein bisschen wichtig gemacht, mit meinem Wissen, den Whiskey gelobt, einen Rye von den Woodford Reserves, von denen ich zwar nur den Bourbon kenne, aber der steht ja auch beim mir daheim an der Wand. Und dann haben die wilden Franzosen, die neben mir zugange waren, den Picon im Regal entdeckt und haben sich ein Picon Bière gewünscht, wo ich sofort nickend unterstützt habe, dass das eine gute Sache sei und so weiter. Im Element? Na ja, ein bisschen hab ich schon gesehen, dass ich da was gelernt hab, die letzten Jahre. Und dann war ich, ich würde gerne sagen, weil sie um zwölf zumachen, plötzlich der letzte Gast. Am Ende bin ich vielleicht noch ein bisschen dings, wehmütig geworden.

Am nächsten Tag bin ich früh aufgestanden, weil ich hab mir einen Ausflug zu den Buckelwalen geleistet. Also bin ich auf, während die Leute in meinem Zimmer noch tief geschlafen haben, sich von ihren jeweiligen Samstagabendexzessen erholend. Das wilde Bubenzimmer am Ende des Gangs… Aber stimmt ja auch gar nicht. Wir sind alle ähnlich gegen Mitternacht daheim gewesen in Wirklichkeit. Die wilden Geschichten hab ich dann erst einen Tag später gehört, als ich auf der Couch im Gemeinschaftsraum gesessen bin und da schräg gegenüber eine Schottin gesessen ist, die laut und relativ freizügig von den Abenteuern ihrer Partie erzählt hat. Aber das tut hier nichts zur Sache und ich hab ihr wirklich mehr wegen ihrer blumigen Sprache zugehört.
Auf dem Weg zum Hafen hab ich mir noch schnell eine Seekrankheitstablette eingeworfen, von denen ich für die Überfahrt nach Steward Island eine Schachtel gekauft hab. Ich bin immer noch nicht sicher, wie man die nimmt und – um hier ein wenig vorzugreifen – ich bin mir mittlerweile recht sicher, dass man die nicht prophylaktisch nimmt. Weil ich hab mir nicht wirklich eine Schachtel gekauft, das sag ich nur, weil ich nicht weiß, wie das heißt, diese silberne Dings, wo man die Tabletten rausdrückt. So eins hab ich mir gekauft, deshalb hab ich auch keine Packungsbeilage. Und ja, ich hätte eigentlich mal nachschauen können. So hab ich eine von den nach Ingwer schmeckenden Tabletten mehr oder weniger so geschluckt. (Und das ist mir ja von Anfang an komisch vorgekommen, dass ich die schlucken möchte, wie die, die so wunderbar auf dem Weg zum Great Barrier Reef gewirkt haben, und sie aber Geschmack haben.) Wie gesagt, vorzugreifen: es ist mir sehr bald sehr schlecht geworden auf dem Walschiff.
Wir sind rausgefahren aus der Bucht und dann merkt man relativ schnell, was man an einer solchen Bucht hat. Nämlich kaum einen Wellengang, which is nice. Es war schon ein schöner Ausflug, die Crew war auch gut aufgelegt und sowohl witzig als auch informativ. Die Walbeobachtungsboote haben so einen Kodex, ich glaub, es werden normalerweise dreißig Meter Abstand gehalten und ab dem dritten Boot dann hundert Meter. Und wenn Kälber dabei sind, dann überhaupt von Anfang an hundert Meter und so weiter. In der Praxis wird das natürlich relaxter gehandhabt, weil die Leute wollen ja einen Wal sehen. Aber immerhin gibt s einen Standard. Natürlich erzählt der Erzähler von den wirklich tollen Begegnungen, weil wenn ein Wal in unmittelbarer Nähe des Boots auftaucht, dann muss das Boot stehenbleiben und dann kann der Wal auch machen was er will und wenn er interessiert ist, dann taucht er halt ein bisschen um das Boot herum und alle auf dem Boot freuen sich. Aber so was hatten wir natürlich nicht. Schade auch, weil wenn er das so erzählt, dann glaubt man ja ein bisschen daran, dass das heute passieren wird.

Die Buckelwale also sind auf dem Weg von der Antarktis in wärmere Gewässer um sich dort entweder fortzupflanzen oder Kinder zu bekommen. Was mir gerade in den Sinn kommt und nicht angesprochen war, warum die Jungtiere auch diesen Weg auf sich nehmen. Weil mit sechs glaub ich hat er gesagt, werden sie geschlechtsreif und im Alter von drei oder vier machen sie diesen Weg zum ersten Mal alleine, vorher sind sie im Gruppenverband mit der Mutter unterwegs. Und prinzipiell sind sie allein unterwegs, nur eben mit Kindern sind sie mal zu dritt oder so. Die große Ausnahme ist, wenn ein paarungsbereites Weibchen ein dutzend Bullen hinter sich herzieht, die sich um Dominanz prügeln. Aber ja, wird wohl irgendwas entweder mit Trieb zu tun haben, wo sie sich gleich einmal gewöhnen, diesen Weg zu gehen, auch wenn sie im Norden kaum was zu essen finden, im Vergleich zu den antarktischen Gewässern. Er hat gesagt, so eine Mutter isst quasi nichts, während sie ihr Kind säugt bis sie wieder zurück in der Antarktis ist. Aber vielleicht hat das doch eine Schutzfunktion, wenn die Jugendlichen nicht allein zurückbleiben und sie Verwandte in Reichweite haben. Weil hören tun sich die ja über hunderte Kilometer, bis nach Queensland rauf, hat er gesagt. Das ist quasi die ganze Ostküste Australiens entlang. Und zwar nicht jetzt immer nur Walgesang, sondern auch wenn jetzt herunten in Sydney einer mit der Flosse auf die Wasseroberfläche klatscht. Ich denke mir dann immer, dass da ja ein irrer Krach sein muss, wenn jeder Scheiß so gut zu hören ist und wie man das als Wal rausfiltert, was da die interessante Information ist und was nur jemand, der vom Luxusliner gefallen ist. Da kann man vielleicht noch was lernen von denen.
Wir sind also einmal in die Richtung eines anderen Walbeobachtungsschiffs gefahren, das den Eindruck gemacht (oder den Funkspruch durchgegeben) hat, dass sie einem Wal zuschauen. Und ist tatsächlich auch gewesen, aber die bleiben bis zu einer Viertelstunde unter Wasser, und so einen Tauchfan haben wir da wohl erwischt gehabt. Also bisschen Wasser in die Luft stoßen, dann abtauchen und Fluke zeigen. Das ist schon was wert, ganz ehrlich, aber mir war da schon schwummrig und ich hab viel auf den Horizont geschaut und mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht hab, wie die Walteile, die ich zu sehen bekomme unter Wasser weitergehen. Wie so viele Beeinträchtigungen ist es auch bei der Seekrankheit schwer vorzustellen, wie sehr man darunter leidet und dass man dem überhaupt zum Opfer wird. Neben mir hat da eine Italienerin darauf verzichtet, hier weiterhin die Standhaftigkeit zu mimen und ihr Sackerl vollgespieben. Aus dem akustischen Äquivalent von Augenwinkel – weil ich hab da dezidiert in die andere Richtung geschaut – hab ich mitbekommen, dass es ein bisschen Probleme mit dem Verschließen des mit patentiertem Drehverschluss ausgestatteten Kotzbeutel gegeben hat. Auch wenn das Ergebnis super ist und man nur eindrehen und einklemmen muss, vielleicht sind die ErfinderInnen zu sehr von Geistesgegenwart ausgegangen, als in der Situation üblicherweise zur Verfügung steht. Aber ich bin da schnell ein paar Schritte weiter gewankt, um die Evakuierung zu erleichtern und selbst besseren Relingszugang zu bekommen. Das würde mir, hatte ich die Hoffnung, gut tun.

Schnell derer enttäuscht, hat sich mir kurz darauf bereits der nächste Silberstreifen in Form eines Wals gefunden, der nah genug aufgetaucht ist, dass wir stehengeblieben sind. Das waren sicher kaum fünfzehn Meter, dass der da vor uns Wasser gespritzt hat und dann wieder abgetaucht ist. Wie gesagt: beeindruckend schon, aber ich nicht in der Verfassung, das zu genießen. Ich hab noch ein bisschen probiert, von meinem Fernglas zu profitieren, aber es ist so schon nicht einfach, einen Wal zu erwischen, wenn er für seine fünfzehn Sekunden aus dem Wasser auftaucht. Dementsprechend schwieriger ist es, wenn man sich mit dem Fernglas den Ausschnitt noch reduziert. Außerdem war meine Aufmerksamkeit yogigleicher Körperbeherrschung gewidmet. Und so wäre ich beinahe überhaupt der Qual menschlichen Daseins gen Nirvana entflohen, hätten mich Neid und Frust gegenüber alle jenen, die in fröhliche Unterhaltungen vertieft keine Anzeichen von Seekrankheit zeigten, mich nicht im Hier und Jetzt gehalten.
Zu meiner Erleichterung wurde dann zur Rückkehr gepfiffen. Um all jene, die diese Entscheidung nicht mit Dankbarkeit empfingen, vielleicht noch für die magere Walsichtungsausbeute zu entschädigen, sind wir dann noch zu den Felsen gefahren, auf denen üblicherweise die Robben rumliegen. Woraufhin ich mich mithilfe meines Mantra des Es-muss-doch-jetzt-gleich-einmal-vorbei-seins wieder dem Ausgleich meiner inneren Organlandschaft gewidmet habe. Und die Robben waren eh nur zwei dunkelbraune Flecken auf helleren Steinen unterhalb eines Steilhangs. Aber die Kameras klickten bereits was das Zeug hielt. Ich dachte daran, dass ich in Neuseeland quasi über diese Tiere drübergestiegen bin, auf der Suche nach den kleinen Pinguinen und hab mich als einziger weiter an der Reling gegenüber wie auch an meinem Magen festzuhalten.
Mit der Einfahrt in die Bucht war dann relativ schnell Entspannung da, wie gesagt, der Seegang, das macht schon was aus. Tags zuvor hab ich eine Plakette gelesen, auf der die Bucht von jemandem gelobt wurde, was sie nicht toll ein großartiger natürlicher Hafen sei, in dem hunderte Linienschiffe ohne großen Aufwand sicher verankert werden können. Daran hab ich gedacht, während es geheißen hat, leider müssen wir noch eine Runde drehen, weil der Hafen so busy ist. Weil der Hafen selbst ist nämlich relativ klein, auch das hat der Mann auf er Plakette für die Nachwelt festgehalten. So sind wir noch unter der Brücke durch und dann war ich. Wirklich. Schon. Sehr. Froh, den berühmten festen Boden unter den Füßen zu haben.
Aber weißt du was. Ich würde wieder. Weil ich weiß doch, dass das eine Gewohnheitssache ist und als ich festgestellt habe, dass Leute hier auf Schiffen anheuern, hab ich mir sofort gedacht, das wär was. Oder als ich gesehen habe, dass ich meinen Bootsführerschein machen kann, hab ich mir auch gedacht: super. Aber nachdem ich nicht weiß, zu was mich das wirklich ermächtigt und zehn Tage dauert, hab ich zumindest den Bootsführerschein jetzt einmal verschoben. Außerdem vergisst man ja schnell, wie hilflos man gegenüber diesem Gefühl ist. Ha!

Den Nachmittag hab ich dann damit verbracht, meinem Körper diesen Mulm auszutreiben. Dazu war ich im Botanischen Garten spazieren, der sich wie gesagt über ein enorm großes Gelände erstreckt und viel davon auch viel mehr Park ist als sonst was. Aber dann wiederum haben sie dort so ein Glashaus, in dem eine Ausstellung zu fleischfressenden Pflanzen gewesen ist, wiederum ganz schön gemacht, fand ich. Klein zwar, aber natürlich bei freiem Eintritt, nur immer wieder mal eine Spendenbox aufgestellt. Das ist mir schon aufgefallen, dass nicht nur beim Eingang eine Spendenbox stand, sondern auch in der Ausstellung und beim Ausgang. Und man mag jetzt sagen, dass das viele Spendenboxen sind. Ja, schon. Aber ich hab nett gefunden, dass es Spendenboxenpositionen gibt, wo nicht ein Personal daneben steht. Man kann dann besser anonym vielleicht nur einen Dollar oder was einwerfen, ohne dass man jemandem gegenüber steht, vor dem man sich vielleicht dafür rechtfertigen möchte. Wär witzig, einen Blick in die Boxen zu werfen um zu sehen, ob die sich deutlich im Münz-Scheinverhältnis unterscheiden…

Langsam geht die Sonne unter und ich liege auf der Wiese und schaue mal in den Himmel, mal auf mein Telefon, weil ich Nachrichten nachhause schreibe. Daneben höre ich den Vögeln zu und beobachte dann und wann auch, wenn einer um mich herumhüpft und vielleicht ein Käferchen aus der Wiese pickt. Es ist gemütlich und ikonisch mit dem Sydneypanorama vor mir.

Tags darauf hatte ich keine großen Pläne, weil ich schon in der Vorbereitung von meinem Sydneyaufenthalt eine Karte für die Madama Butterfly gekauft hatte. Deshalb bin ich am Vormittag nur einmal Richtung Westen geschlendert, um abseits meiner Nord-Süd-Achse, auf der ich von meinem Hostel in die Innenstadt gehe, auch ein bisschen Sydney zu erkunden. Latent hatte ich das Aquarium und den Fischmarkt im Kopf. Fischmarkt irgendwie immer was aufregendes und bietet um kein Geld eh ein ähnliches Abenteuer wie das Aquarium. Ich war nicht darauf vorbereitet, was da im Fischmarkt los war. Ich hab gedacht, da wird eine große Markthalle sein und drinnen sind die Standler und ich lauf da ein bisschen durch, als einer von wenigen, die nicht hier sind, um sich einen Fisch zu kaufen. Nun. Es ist dann zwar eine große Markhalle gewesen, aber ziemlich durchorganisiert. Da waren drei oder vier Fischgeschäfte drinnen, die alle etwa gleich strukturiert waren. Für mich am aufregendsten und vielleicht auch Grund für viele von den AsiatInnen und asiatischstämmigen AustralierInnen, denen ich hier begegnet bin – nämlich sicher acht von zehn Leuten, die im Fischmarkt unterwegs waren – war, dass jedes Geschäft eine Sashimibar hatte. Oh yeah. Da geht man dann hin und sagt, das und das und das. Und sie sagt: aufschneiden. Und ich sag: ja bitte. Und dann hab ich einfach eine Tasse mit meinem rohen Fisch bekommen, ein Töpfchen Sojasauce mit Wasabi drin und kein Reis und nix sonst. (Da hab ich mir noch einen chinesischen Algensalat gekauft, der war sehr gut.) Damit hab ich mich in die Sonne gesetzt und das war wirklich sehr gut. Auch nicht viel billiger, als der Eintritt in das Aquarium gewesen wäre. Ich hatte zwei Ich-glaub-Jakobs-Muscheln, die sie horizontal halbiert hat, die waren ein Traum. Nein, das war sehr gut, wenngleich es mir schon ein wenig absurd vorgekommen ist, dass ich tatsächlich einfach einen Teller voll ungewürztem, rohem Fisch esse. Es hat schon was faszinierendes, auch wenn ich Sushiessen jetzt nicht unter der dubiosen Kategorie Exotisches einordnen würde. Auf die Austern hab ich dann verzichtet, weil ich mich tatsächlich ganz gut angegessen hatte, mit meinem Sashimi. Das tut mir schon ein bisschen leid, auch wenn ich wahrscheinlich auch das Gefühl hatte, dass das ein bisschen eine soziale Unternehmung sein sollte und allein Austern essen irgendwie… weiß nicht. Ich glaub, die Idee, sich an Austern satt zu essen kam mir ein bisschen unziemlich vor, von wegen Luxuskonnotation und so. Und es hätte noch viele Alternativen gegeben gegrilltes, gebratenes, überbackenes…

Am Abend gab s dann dann die Madama Butterfly. Erstens hat s mir wirklich gut gefallen. Ich mein, das ganze Setup war ein bisschen ungut, weil die Übertitel nur wenige Meter näher an der Bühne waren als ich und ich mich ziemlich hab winden müssen, um lesen zu können, was gesungen wird. Auf der anderen Seite, quasi zweitens, ist die Sydneyer Oper sehr bemüht und nicht nur dass sie mir eine Woche vorher Hintergrundinformationen per Mail geschickt haben, hat auch jede BesucherIn ein Programm bekommen in dem einige Informationen enthalten waren, nicht zuletzt eine Übersicht über die Handlung der drei Akte. Insofern war der Handlung durchaus zu folgen. Vor mir ist eine Sagen-wir-Achtjährige mit ihren Eltern gesessen, ich glaub, für die ist sich der Blick auf die Übertitel nicht mehr ausgegangen. Die hat sich dann auch bald einmal schlafen gelegt. Aber die Eltern haben trotzdem interessiert geschaut und es war ja auch schön gesungen und man hat doch noch das meiste gesehen, was auf der Bühne passiert. Ja, es gibt auch billige Plätze im Joan-Sutherland-Theatre. Außerdem gibt s geförderte Sitzplätze, das hab ich schon auch wieder gut gefunden. Da gibt s Sponsoren, die dann verschiedenen benachteiligten Gruppen Zehn-Dollar-Plätze ermöglichen. Aber ja, ich hatte nicht ideale Sicht, aber immerhin keine Säule, wie ich befürchtet hab. Ich glaub, es gibt da gar keine Säulen, so modern ist die Oper.

Gutes Programm ansonsten auch, weil es in Australien, mit dem großen Anteil an asiatischstämmigen EinwohnerInnen vielleicht ein bisschen sensibler ist, diese Geschichte zu erzählen, von der Japanerin, die im All-Inclusive-Deal mitsamt dem Haus an einen Amerikaner verkauft wird, um dann von ihm stehengelassen zu werden wie die reinste Medea. Weil an die hab ich schon immer wieder mal denken müssen. Und in diesem Vergleich mit Medea ist es natürlich auch nochmal mehr eine Kolonialisierungsgeschichte. Ms Pinkerton gibt übernimmt die amerikanische Kultur, was in erster Linie heißt, dass sie zum Christentum konvertiert und amerikanisches Eherecht für sich in Anspruch nimmt. Aber wurscht, weil sie trotzdem ignoriert wird. Tragischer vielleicht als Medea, weil die sich in ihrer Verzweiflung zumindest wehrt während sich Cio-Cio-San (Ms Butterfly ist ja wohl ihr Sklavenname) begegnet ihrem Schicksal mit Autoaggression, d.h., sie schafft lieber sich selbst aus dem Weg statt der Familie. Und als in der allerletzten Szene, als sie sterbend daliegt, noch der Herr Pinkerton bei der Tür reinkommt und sie in den Arm nimmt, da wär es schon gut gewesen, wenn ihm wer was an den Kopf wirft. Nicht mal allein sterben darf sie sondern muss noch mit dem Schuldgefühl von ihrem blöden Gatten konfrontiert werden. Da war ich schon aufgewühlt. Aber diesmal halt im Gefühl statt im Magen.

Anyway. Die Cio-Cio-San ist von einer Asiatin gespielt worden, während viele in ihrem Stab von EuropäerInnen dargestellt wurden, jetzt: phäno– und idealtypisch. Zuerst hab ich gedacht: das ist schon ok. Dann hab ich gedacht: muss wohl jede asiatisch aussehende Sopranistin die Cio-Cio-San spielen? Ist nicht so einfach… Wahrscheinlich haben sie s ganz gut gelöst, dass die Verwandtschaft und sonstige japanische Bevölkerung mehr durch ihre Kleidung als durch ihre Gesichtszüge als solche erkennbar gemacht wurden.
Na und sonst hat mir auch das Bühnenbild ganz gut gefallen. Nicht wirklich was besonderes, also, hat man alles schon gesehen: sich drehende, asymmetrische Plattform von einem weiteren, sich drehenden Ring umgeben. Und von den Wänden große Projektionsflächen, die je nachdem eine abstrakt die jeweilige Umgebung und/oder Stimmung dargestellt haben. Auch hier gab s natürlich so einen Moment, wo dann japanische Schriftzeichen herumgeflogen sind und ich hab mir gedacht, die können sich hier wohl kaum leisten, hier einfach nur für ein exotisches Flair zu sorgen, das muss schon auch eine Bedeutung haben, wenn die da so aufgereiht, anscheinend in Sätze geformt über die Leinwände driften.
Ich mein, es ist schon ein bisschen ein TouristInnenprogramm, natürlich. Aber dafür hatten sie im Eingangsbereich auch eine Weltkarte aufgestellt, wo man sich mit einem Pickerl hat eintragen können, woher man kommt. Und wenig überraschend haben wir wenige Gäste aus Afrika, Zentralasien oder Südamerika da gehabt. Hingegen war Europa, Japan oder auch die Pazifikküste der USA ziemlich zugestickert. Aber auch Australien und vor allem Neuseeland. Vielleicht gehört das dazu, dass ich hier ja selbst in der BesucherInnenrolle war, aber ich fand s aufregender, als das eine Mal, als ich in der Staatsoper in TouristInnenbegleitung Fidelio gesehen hab.

Den letzten Tag in Sydney hab ich dann auf der Post, im Park und im Zaubermuseum verbracht. Eigentlich hätte es andersherum sein sollen, aber als ich kurz vor der ausgemachten Zeit vor dem Zaubermuseum stand, war da nichts. Also nicht gar nichts. Ein bisschen hab ich zwar schon gedacht, ah, der wird jetzt um halb punktgenau in einer Staubwolke erscheinen. Oder sowas in der Art. Aber war nicht. Fünf vor halb hat mich die Bürokraft angerufen und gefragt, ob ich auch den Abendtermin wahrnehmen könnte, dem Zauberer geht s nicht so gut. Hab ich gesagt nein, das nicht, aber wenn sie s verschieben will, das ist mir recht. Also haben wir s verschoben und ich hab zuerst meinen Reiseführer heimgeschickt, was mich mehr kostet, als der wert ist, aber für irgendwas muss ich meine Scheine ja ausgeben. Und den wollte ich wirklich nicht mehr mit mir herumtragen.
Und dann war ich total gute Ramen essen, an der Bar und überhaupt, das hat sich schon gut authentisch angefühlt. Auch weil zum Beispiel auf der Speisekarte zwanzig Suppen abgebildet (und trotzdem hat sich s authentisch angefühlt!) waren, die sich optisch eigentlich kaum unterschieden haben. Auch erwähnenswert ist, dass ich mich nicht angepatzt hab und das ist ein bisserl ein First für mich und meinen Ramenkonsum.

Der Zauberer ist dann zum neuen Termin aus seiner Tür gestiegen, ohne Rauch, ohne Tricks, ohne alles. Und dann hat er gesagt, ich bin der einzige und dann hab ich schwören müssen, nichts weiterzusagen, von dem, was ich in der nächsten Stunde lerne. Und weil das der Magierschwur war (so oder so ähnlich), bin ich jetzt, glaub ich, streng genommen ein Zauberer.
Jetzt die Tour. Es ist ja so, dass man sich dafür anmelden muss, es ist jetzt nicht ein Museum, wie man sich das vielleicht vorstellt, wo man vorne reingeht, dann bisschen rumgeht, eine Handvoll tolle Sachen hinter Glas sieht, teuer an die Wand geklebte Beschriftungen liest und dann im Giftshop lange witzigen Schrott anschaut bevor man maximal eine Ansichtskarte kauft. Es ist eine individuelle Führung, wo er zwischendurch zwei Tricks gezeigt hat und dann erklärt bisschen und fundamentale Prinzipien und ein bisschen Geschichte und Showbusiness und dann noch zwei, drei aufwendige Bühnentricks erklärt. Und zwischendurch hat er manchmal ein bisschen geschimpft auf VeganerInnen, die keine Ahnung haben, aber das nicht ok finden, wenn ZaubererInnen mit Tieren arbeiten. Oder PolitikerInnen, die die Aufmerksamkeit der Menschen misdirecten würden, wohingegen ZaubererInnen dieselbe bloß guideten. Interessant fand ich, dass er gemeint hat, Zauberei sei sehr stark eine Sache des Gefühls, viel mehr als des Geistes, dass er schnell ein Gefühl für s Publikum gewinne, in der Lage sei, schnell Sympathien und Widerstände und dergleichen zu erfassen. Oh-o, hab ich mir gedacht, ich will jetzt aber nicht, dass er erkennt, dass ich ihm als Person langsam ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, so wie er vor sich hinredet.
Nah, ich glaub, das war schon ganz ok und einiges wirklich interessant. Und wir waren dann ein bisschen schneller fertig als geplant, ich hatte den Eindruck, meine Fragen und Anmerkungen gehen an ihm ein bisschen vorbei, er redet lieber über seine Sachen. Aber ja, ich mein, er hat sich nicht so gut gefühlt und hat dann für eine Person seine Tour gemacht. Und ich bin offensichtlich nach wie vor nicht jemand der sich da aufstellt beziehungsweise einen Aufstand macht, wenn der Konsum nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und vielleicht auch ein bisschen verwöhnt von der Museumskultur hier im allgemeinen, dass ich dann so schnell ins kritisieren komm, wenn ich mal für was Eintritt gezahlt habe.
Und dann war ich ratzfatz im Hostel und ratzfatz am Flughafen und ein letztes Mal hab ich noch der Versuchung widerstanden, ein Stoffschnabeltier zu kaufen. Ich mein, in Wahrheit hab ich das beste Stoffschnabeltier im Zoo-Shop vom Melbourner Zoo gesehen, weil das war schön und es war eine Handpuppe auch. Das war super. Und das zweitbeste hab ich dann ab und zu mal gesehen und das hätte es sogar noch am Flughafen gegeben, hat aber dort zehn Dollar mehr gekostet, als ich noch hatte. Also hab ich jetzt meine Dollar mit ins Ausland genommen und jetzt kein Stoffschnabeltier im Gepäck.