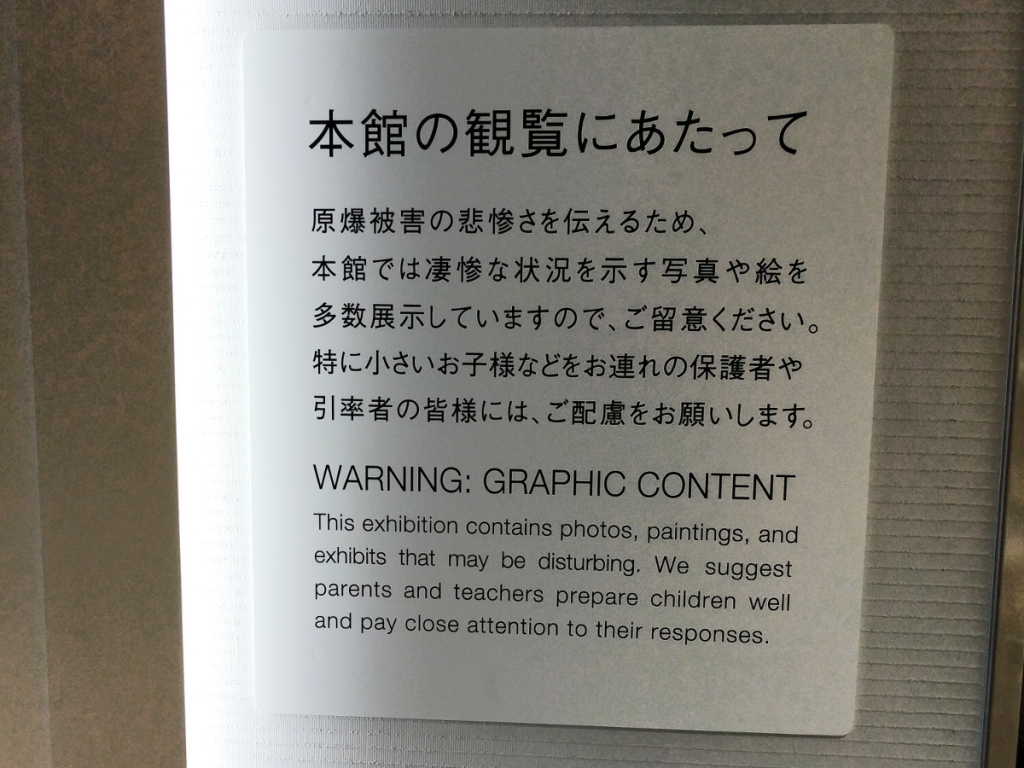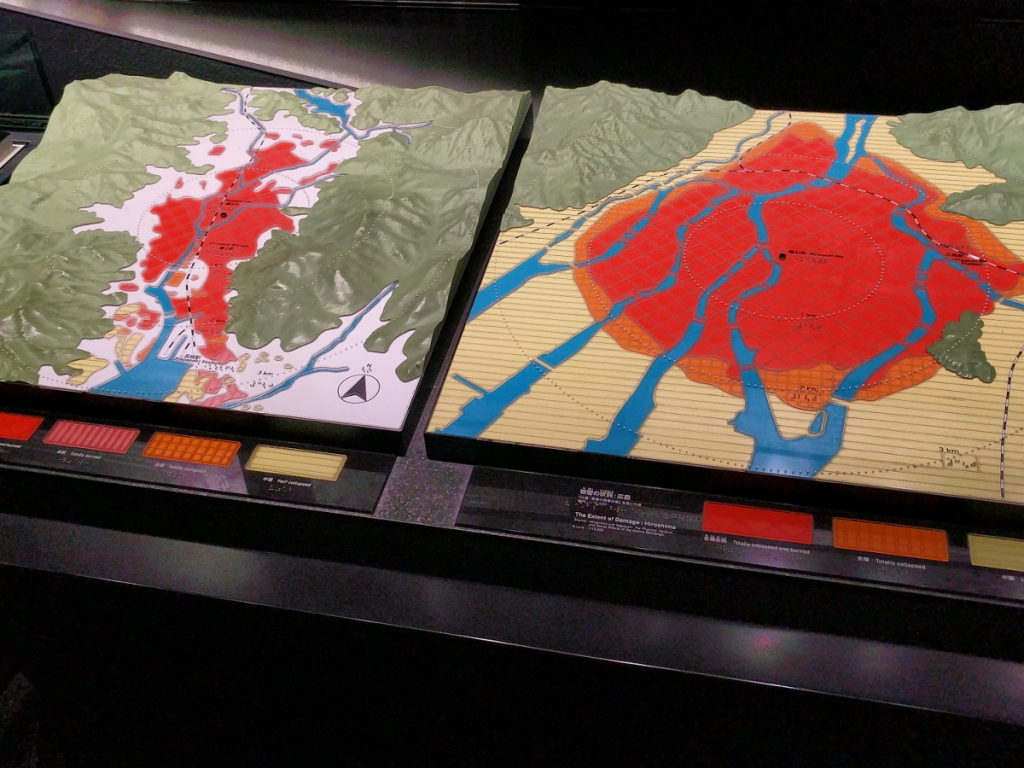Dann kam der Moment und der Moment brachte M. Ich bin nicht mehr allein unterwegs und das ist erfrischend. Die Welt direkt zu kommentieren, einen zweiten Blick zur Verfügung zu haben. Aber es eröffnet nicht nur Möglichkeiten, es frisst auch Zeit, frisst die Zeit, in der ich mich langweile und nach Gesellschaft sehne. Frisst die Zeit in der ich meinen Gedanken nachhänge und Zeit in der ich mich besinne und die Vergangenheit in eine Form bringe. Eine nachhaltige Form des So-ist-es-passiert. Geschichte schreiben.
Eben war ich noch in der österreichischen Botschaft und erlebe die Heimat als bürokratischen Verwaltungsapparat, wenn ich mich für den Eintritt erklären muss und dann ein dickes Kuvert überreicht bekomme. Aber mit Erleichterung stelle ich fest, dass ich nicht der einzige, dass ich nicht der letzte bin, der hier seine Wahlkarte in Empfang nimmt. Und dann viel zu viele Namen und Listen und ich mach mein Kreuz und steck meinen Wahlzettel ins Kuvert, den Rest in meine Tasche. Und jetzt liegt selber der Effekt dieser Handlung schon in der Vergangenheit. Ein paar Tage später lese ich übrigens die Listen und wunder mich, warum Parteien mehr Leute auf ihre Listen setzen als es Plätze im Parlament gibt. Ja, ja, da sind wohl irgendwelche Vorzugsstimmenwahlkämpfe versteckt, aber so die Listen durchzublättern und auch nur 183 Leute auf einer Liste zu sehen wirkt ein bisschen nach Arroganz.

Insgesamt gibt s für mich sonst nicht viel zu tun in der Botschaft. Ich überfliege schnell einen Prospekt über österreichische Kulturveranstaltungen August bis September und sehe, dass ich eine Klimtausstellung in Osaka verpasst habe. Aber ich bin insgesamt schnell wieder draußen und wander noch ein bisschen verloren durch die Gassen des – wie ich annehmen muss – Botschaftsviertels. Warum sonst würde ich hier so viele blonde Frauen auf Fahrrädern-mit-Kindersitz-hinten-drauf sehen. Und obwohl ich Tokio deutlich weniger fordernd finde, als vor zwei Wochen, lauf ich dann vor lauter Tokio doch noch über eine rote Ampel. Neben mir bremst ein größeres Auto, aber so sanft, dass ich es überhaupt erst bemerke, als es bereits stehengeblieben ist. Natürlich ein bisschen ein Schreck auf meiner Seite. Und sofort denke ich, dass das jetzt wirklich nicht… also natürlich war das mein Fehler. Ich hab nicht damit gerechnet, dass zwei aufeinanderfolgende Ampeln nicht gleichgeschaltet sind, selbst wenn die Verkehrsinsel zwischen den zwei zu überquerenden Straßen nur drei, vier Meter breit ist. Auf besagter Verkehrsinsel steht eine uniformierte Person und sofort bin ich als braver österreichischer Staatsbürger für eine unterwürfige Geste zu haben. Aber nichts da: die Person in Uniform schlägt selbst die Augen zu Boden, reagiert das offizielle Tokio also eher mit Enttäuschung als mit Strafe auf meine Gesetzesschramme?
Auf dem Weg zurück zum Bahnhof such ich mir noch ein schickes Kaffeehaus, in dem ich nicht nur eine Tasse indonesischen Kaffee trinke, sondern mithilfe der Möglicherweise-e-die-Besitzerin meine Postkarte an das hiroshimanesische Restaurant adressiere. Und dann heißt s mich sputen, damit M nicht allzu verloren auf dem Bahnhof herumsteht. Wir haben noch einen Zug zu erwischen und er hat elf Stunden Flug hinter sich, ich bin mir sicher, der möchte sich setzen. Ich hab noch ein Internet auf meinem Telefon, aber die freien Wifis, die in der Stadt zu finden sind, sind nicht immer einfach und ich bin nicht sicher, ob meine Beschreibungen des idealen Treffpunkts so verstanden werden, wie ich mir das erträume.
Aber alles kein Problem, da steht er schon, unerwartet frisch und munter, den Railpass in der Tasche und ein dementsprechendes Lachen im Gesicht. Es geht fast alles ein bisschen zu glatt. Ein fröhliches Hallo und auch nach acht Monaten gleich in die selbe Vertrautheit zurück, wie in die Lederhandschuhe vom vorigen Jahr. Im Shinkansen kriegen wir bloß Sitze hinter- beziehungsweise voreinander, aber mit einem Blick durch die Sitzreihen zurück stelle ich fest, dass das auch nicht so schlecht ist, weil dann kann sich M noch ein bisschen ausruhen. Ist ja doch eine lange Reise. Von Wien nach Tokio, von Tokio nach Hakodate.
Weil wir sind jetzt noch stundenlang unterwegs, inklusive einer unauffälligen Querung der Meerenge zwischen Honshu und Hokkaido. Weil es draußen bereits dunkel geworden ist, merken wir kaum, dass wir in einen Tunnel hinein und aus einem Tunnel wieder hinaus sind. Glücklicherweise bekommt M von seinem Sitznachbarn über gemeinsames Gestikverständnis erklärt, wie ein Tunnel funktioniert, erfahre ich später. Und eine getrocknete Jakobsmuschel, die zugegebenermaßen sehr wie ein Karamellbonbon ausschaut, und deshalb umso mehr für den eben noch aus Europa geflogenen Gaumen ein bisschen eine Überraschung darstellt.
In Hakodate finden wir zu unserem Schachtelhotel, ein kleiner Spaziergang durch unsere erste Stadt Hokkaidos. Es ist schon einmal deutlich kühler als in Tokio, mich friert s fast ein bisschen auf den von meiner Hose nur halbbedeckten Wadeln. Im Schachtelhotel werden wir enthusiastisch begrüßt und es wird uns ein Foto mit Fahne in der Hand abgenommen. Ich mein, einfach weil sie tatsächlich eine österreichische Fahne dort stehen hatten, das hat mich einen Moment lang beeindruckt. Weil zuerst hat man uns die australische Fahne angeboten und wenn ich nicht gedacht hätte, dass sie jetzt sicher keine österreichische da stehen hätten, hätte ich die ja nicht abgelehnt. Im Zweifelsfall nämlich sowieso lieber mit der australischen, nicht weil ich lieber mit einem australischen Pass herumlaufen würde, einfach weil die Abstraktion eine größere ist, wenn ich mich weniger mit der Fahne identifizier (ob ich will oder nicht), die ich in der Hand halte. Und dabei sind wir bei weitem nicht die einzigen euro-amerikanischen Gäste. Der Enthusiasmus scheint wirklich Standard zu sein.

Ein erstes japanisches Abendessen für den Freund von daheim in einem guten aber von sehr distanzierten Unternehmern geleiteten Rahmenlokal. Daheim gibt s noch einen Becher Gerstentee, bevor wir in unsere mit Rollo verschließbaren Bettkabinen kriechen. Wie Aschenbecher, sagt er und meint den Tee. Aber auch in unseren Schlafverschlägen ist es spätestens am Morgen heiß und stickig.
Wir verlassen das Hotel ohne die hunderttausend Freizeitangebote in Anspruch genommen zu haben, die uns zur Verfügung gestellt werden. Ich hab kurz die Kalligraphie ausprobiert und schnell festgestellt, dass mein Asienaufenthalt meinen plumpen Pinselstrich nicht beeinflusst hat. Am Klavier spiele ich wohl nicht einmal eine Melodie sondern tappe nur ein kurzes ping-ping um eine Idee vom Klang zu bekommen. Sofort springt jemand hinter der Rezeption auf und man deutet mir zur Motivation, ich solle doch, ich würde doch bitte. Aber wir haben schon die Rucksäcke umgeschnallt und machen uns auf den Weg zum morgendlichen Fischmarkt.
Den morgendlichen Fischmarkt haben wir um zehn natürlich längst verpasst, aber es gibt noch den, naja, den normalen Fischmarkt, I guess, auf dem die größte Attraktion ein Aquarium ist, aus dem sich KundInnen selbst ihren Tintenfisch angeln können. Das kommt mir dann doch ein bisschen gar grob vor, irgendwo hat ein Tintenfisch ja doch ein zur Empathie einladendes Goscherl und die zwei großen Augen und die eindeutige Panikreaktion, als er am Haken aus dem Wasser gezogen wird und selbst Wasser auf die AngreiferInnen spritzt. Letztlich hindert s mich aber doch nicht daran, mir in der nächsten Halle ob der begrenzten Auswahl einen gegrillten Tintenfisch zum Kaffee zum Frühstück zu bestellen. Aber der Vegetarier in mir werkt schon in derartigen Situationen und er ist in den letzten Wochen lauter geworden, stellt Ansprüche während ich „einfach nicht dazukomme“ nachzusehen, ob es der Gelbflossenthunfisch oder der Blauflossenthunfisch ist, der derart überfischt ist. Es ist einfach nicht richtig.

Nächster Halt: Asahikawa. Lustigerweise kommt da gar nicht das Bier her (Asahi), zumindest nicht, dass wir das herausgefunden hätten. Es gibt nämlich zwei, sagen wir, drei. Es gibt drei große Bier in Japan. Kirin. Sapporo. Asahi. In Japan und außerhalb. In Australien zum Beispiel gibt s kaum ein japanisches Lokal, das nicht Asahi ausschenkt. Es ist auch sonst ein beliebtes Bier, so weit ich mich erinner. Und vor einem halben Jahr hab ich noch gedacht, dass es sich bei Asahi um eine Kette japanischer Restaurants handelt, weil ich das so miteinander verbunden hatte ohne mich wirklich für s Bier zu interessieren. Und jetzt ist das ja auch nicht im Fokus, wenngleich man sagen muss, dass der Besuch von zuhause schon auch die eine oder andere Gewohnheit von daheim mitgebracht und in meinen Alltag zurückimportiert hat. Also zum Beispiel, dass ein Bier nicht nur eine Begleitung für ein Abendessen ist, sondern so einem Glas in den Zustand innerer Leere zu verhelfen auch ein abendliches Zusammensitzen begleitet. Das kommt wie von selbst und ich bin ein bisschen unzufrieden damit, wie schnell das wieder den Rang einer Selbstverständlichkeit angenommen hat. Das ist doppelt schade, weil einerseits torpedier ich mir damit ein bisschen das Zusammensitzen, wenn ich mir nicht gegen die schlechte Laune zu helfen weiß und auf der anderen Seite ist es halt auch einfach ein bisschen bedauerlich, dass das eine gemeinsame Freizeitbeschäftigung ist, zu der mir in der Situation auch keine Alternative einfällt. Ich mein, wir schießen uns ja nicht weg, aber das eine Bier, das vor ein paar Wochen noch eine erwähnenswerte Ergänzung meiner Abendessen in Japan war, das sind halt jetzt zwei.

Asahikawa ist jetzt aber wirklich schon weit im Norden und es ist kühl genug, um im Rucksack nach den Jeans zu kramen. Die Leerstelle ist schnell mit den Flipflops gefüllt, auch die brauch ich heroben nicht. Als wir in einer kleinen Gasse unsere Unterkunft gefunden haben, sagt die Besitzerin, dass sie keine Duschen hat und ich denk mir, das erklärt, warum das so billig war und sag, das sei kein Problem, es sind ja nur zwei Nächte und wenn sie sagt, nebenan gibt s ein öffentliches Bad, dann passt uns das. Ob ich mich einmal nach M hätte umdrehen sollen, bevor ich den neuen Umständen zugesagt hab – könnte sein. M ist in mehrfacher Hinsicht nicht ganz glücklich mit dem etwas urigen Ambiente. Und es stimmt schon: die Stufen sind so steil, dass sie durchaus an die Gefährlichkeit grenzen, das Klo ist drei Stockwerke entfernt und der Eingangsbereich ist eine Mischung aus Bar und Wohnzimmer, tief hinten in einer Einfahrt und bar jeglichen Sonnenlichts. Außerdem ist das Zimmer einfach nicht hoch genug, dass M aufrecht stehen kann. Und wo die Besitzerin freundlich und bemüht ist, kann man das möglicherweise auch als ein bisschen zu wenig distanziert wahrnehmen. Das ist dann auch irgendwo die Schwierigkeit zwischen meinem Driften, meinem Willen zur Sparsamkeit und dem Mann, der doch gekommen ist, um Urlaub zu machen und nicht unbedingt bereit ist, mit Komforteinschränkungen für seine Übernachtungen zu zahlen.
Aber schön, mit dieses Bedürfnisschräge werden wir die nächsten zwei Wochen zu tun haben und jetzt sind s ja nur zwei Nächte. Und jetzt sitzen wir erst einmal über einem mongolischen Grill, was einfach als Genre Dschingis Khan heißt. So wie ein Essen Fondue heißen kann oder Brettljause. Ich glaub nicht, dass das ok ist, das so zu nennen, aber es schmeckt auf jeden Fall. Und es ist das erste Mal, dass ich am Boden sitzend mein Essen einnehme. Vor ein paar Jahren bin ich mit dem Funfact herumgelaufen, dass die JapanerInnen heute (und ein paar Jahren) im Schnitt um so-und-so-viele Zentimeter größer sind als noch vierzig Jahre zuvor, weil sie die traditionelle Art des Am-Boden-Kniens-Slash-Sitzens zugunsten von Stühlen aufgegeben hätten. Natürlich ist der Fun in dem Fact eher, dass es eine Behauptung ohne Quellenangabe ist und vielleicht letztlich… es erscheint jetzt einfach nicht besonders logisch.
Am Plan steht eine Besteigung des Asahidake im Daisetsuan Nationalpark. „Spielplatz der GöttInnen“ heißt es in den Broschüren und in der Gondel, die wir letzten Endes doch den Berg rauf nehmen. Weil unten ist es gatschig und der Weg scheint, seit sie die Gondel gebaut haben, nicht mehr tip-top in Stand gehalten zu werden. Aber vielleicht war er s nie und mein impliziter Vorwurf der kapitalistischen Logik ist ungerechtfertigt. Beim Erkundschaften möglicher Besteigungsrouten haben wir immerhin zwei Herren mit Helmen im hohen Gras erspäht, die schienen den Weg zu erneuern, aber das waren nur die ersten hundert Meter und das ist zu wenig für einen Zweitausender. Außerdem hab ich im hohen Gras eine Schlange gesehen und der M hat sowieso nur seine Laufschuhe mitgebracht, also verzichten wir auf das Abenteuer durch den Busch und, ja, Gondel.

Leider ist die Situation oben auch nicht ideal. Oder: kommt wahrscheinlich drauf an, was man sich wünscht. Es liegen nämlich zwanzig Zentimeter Schnee und dass es noch ein bisschen zu warm für den Schnee ist, ist dann auch keine Erleichterung, weil so hat M bald die Schneeschmelze bis zu den Knöcheln, während wir mit den vielen anderen BesucherInnen gemeinsam über die engen Wege rutschen. Es ist schon schön, das lässt sich auf jeden Fall sagen und auch M vergisst die nassen Füße, als die Luft schwefeliger wird und die Begeisterung für die aus dem Berg stoßenden Dampfschwaden einsetzt. Ein Vulkan ist einfach was lässiges. Und wenn der heiße Dampf aus einer Schneedecke hervorquillt, dann ist das noch eine Stufe lässiger. Leider sind die Kontraste nicht so gut, weiß auf weiß und bewölkter Himmel. Und auch wenn s nicht Indonesien ist und deshalb schon dreißig Meter vor den Austrittslöchern eine Absperrung aufgebaut und fleißig bewarnschildert wurde, es ist halt trotzdem super. Irgendwer hat auf dem Rastplatz ein Schneeschwein geformt, das war auch super. Sonst gilt als die lokale Hauptattraktion die Ausstellung der Jahreszeiten und jetzt eben der Herbst-Winter Übergang. Daisetsu Nationalpark sei üblicherweise jene Gegend, wo sich die Blätter zuerst verfärben, wo der erste Schnee fällt und so für Japan jene Jahreszeiten einläutet. Immerhin der höchste Berg Hokkaidos. Es wirkt jedoch fast ein bisschen frühlingshaft, aber die Blumen, die da scheinbar als die ersten durch den Schnee stoßen, sind eher die letzten, die von der Kälte gerafft werden, aber das sieht ja nur, wenn man s weiß. Nur hie und da zeigt sich der Herbst auf dem Laub, das satte Grün ist vielerorts nur vom Schnee verdeckt.

Zurück im Tal gibt s einen Onsen, der die schneenassen Füße wärmt (wer s braucht) und uns außerdem die fehlende Dusche in der Unterkunft kompensiert. Wir kaufen unabsichtlich zwei Handtücher, weil Ausborgen spielt s nicht für uns, die wir nicht Gäste im Hotel sind. Aber die damit verbundenen Kosten sind so gering, dass ich nicht auf die Idee gekommen wäre, dass wir die tatsächlich erwerben. Gut vielleicht, dass wir uns mit kleinen Handtüchern zufrieden gegeben und nicht das volle Set erstanden haben.
Aber alles in allem ist alles in Ordnung. Der Bus schupft uns heim und wir machen uns ein gemütliches Abendessen in einem Ramengeschäft. Wir sind vielleicht ein bisschen irritiert über den offenbar europäischen Hintergrund der einen Kellnerin, es ist einfach sehr unüblich, die nicht-asiatischen GastarbeiterInnen in Japan. In der einen oder anderen Jugendherberge sitzt mal eine EuropäerIn an der Rezeption, aber das ist es wirklich. Und lustig, wie das von außen dann immer gleich so so ausschaut, als spräche sie ein makelloses Japanisch. Die Sprache ist so fremd, dass ich ja wirklich nichts verstehe (ab und zu mal eine der ersten drei Ziffern) aber schon gar nicht beurteilen kann, wie eloquent oder auch nur wie flüssig sich jemand auszudrücken weiß. Und selbst die Gestik und paraverbale Gesprächsanteile unterscheiden sich noch einmal merklich, sodass jemand mit ein bisschen Japanischkenntnissen dann oft schon extremst bewandt.
Nach Asahikawa sind wir nach Sapporo. Zunächst haben wir das ja anders herum geplant gehabt, dass wir zuerst einen Sprung nach Sapporo machen und von dort weiter nach Asahikawa. Aber schau an, es hat kurzfristig echt null Unterkunft für uns gegeben. Ok, nicht null, Sapporo ist ja doch recht groß. Aber in der Nähe des Zentrums und in einer recht engen Preiskategorie haben wir für den nächsten Tag nichts gefunden. Jetzt kann man sagen: Zufall. Oder man sagt: Rugbyworldcup. Hab ich mich mit meinen Befürchtungen doch ein bisschen bestätigt gefühlt. Wahrscheinlich war s so herum dann eh besser, weil wir ja auch einen Taifun mitgebracht haben und das schlechte Wetter in der Stadt sicherlich leichter zu umgehen war als draußen am Spielplatz der GöttInnen. Viel leichter nämlich, hat sich dann herausgestellt, als wir mit bereits nassen Füßen nach einer halben Stunde Stadtquerung herausgefunden haben, dass zumindest das Stadtzentrum mehr oder weniger untertunnelt ist und wir zumindest von unserem Kaffeehaus aus einfach unterirdisch herumgelaufen. Ich mein, viel gibt s nicht: Geschäfte und Lokale. Aber was braucht man schon viel mehr. Ich laufe meinen Spielkarten hinterher, die s nirgendwo gibt und für s Mittagessen sind wir dann sogar aus dem Untergrund heraufgekommen und haben uns die Füße auf dem Weg zum Fischmarkt benetzt. Essen gehen ist gemeinsam ja auch um ein vielfaches schwieriger, als allein. Ich mein, erstmal, dass die Hungerzyklen synchronisiert werden. Dass die Snacklust angepasst ist. Das ist alles nicht so einfach. Auf der anderen Seite erlaubt s halt auch ein bisschen was experimentelleres, wenn ich mein Gegenüber endlich auf Austern überredet hab, die ich mir allein nicht geben wollte. Jetzt sitzen wir auf jeden Fall über Sashimischüsseln, für die Aufregung hier verschiedenen Krebsen ans Bein zu nagen und Seesternrogen zu futtern, hab ich dann doch ganz schön auf s Wechselkurserinnern verzichtet. War dann eh auch fein, wobei ich sagen muss, dass mir nicht zuletzt in Erinnerung ist, dass ich dort den besten Reis gegessen hab.

Am Abend sitzen wir mit zwei Flascherl Sake in unserem vergleichsweise schicken Hotelzimmer. Sein Sake in den Eiswürfeln, mein Sake im Wasserkocher. Ich hab viel Zeit für ein Getränk, das sich warm und kalt trinken lässt ohne ekelhaft zu sein. Beim Aufräumen hat das Hotelpersonal mein unabsichtlich gekauftes Handtuch eingepackt und ich bin ok damit. Kurz überlege ich, dafür eines der hotellernen einzustecken. Aber erstens: nein. Und zweitens brauch ich ja kaum ein zweites Handtuch und sollte froh sein, dass mir das mit so wenig Eigeninitiative abhanden gekommen ist. Im Fernsehen gibt s Rugby und Go und eine Gesprächsrunde bei der sechs Leute um einen Tisch herumsitzen und Whisky trinken: Zwei Japanerinnen, drei Japaner und ein Ausländer, der bei uns daheim wohl nicht als solcher auffallen würde. Dann gibt s noch eine Sendung mit zwei Chinesinnen Anfang zwanzig, die durch die von einer Kamera verfolgt durch die Stadt spazieren und verschiedene Touristenattraktionen besuchen. Ehrlich gesagt kommt mir aber die Zeichentrickserie auf dem nächsten Kanal, in der die ProtagonistInnen in erster Linie Frauen mit way überzeichneten Proportionen sind, weniger sexistisch vor. Letztlich sitzen wir dann vor der zweiten Hälfte von Back to the Future Part III, die ganzen Ungenauigkeiten kritisierend, die man als Teenager gerne mal übersehen hat.
Am Vortag, unter passablen Wetterbedingungen, sind wir sogar ein bisschen an Sapporos Oberfläche herumgelaufen. Wir haben jetzt aber auch nicht irre viel für uns in der Stadt entdeckt. Ein bisschen durch die Straßen spaziert, den Fluss entlang und durch einen Park wieder zurück. Wobei wir, nicht uninteressant, auf eine Hochzeitsgesellschaft gestoßen sind. Also, zuerst war da so Krach im Park und auf dem Plan hat s ausgeschaut, als ob dort irgendein Musikhaus wäre. Interessant, hab ich gedacht, da machen sie vielleicht ein Gegenprogramm zum Rugger. Aber dann sind wir auf einer Parkbank gesessen und haben aus sicherer Entfernung (sowie des einsetzenden Abends) da wirklich einer Zeremonie zugeschaut. Dann ist die Gesellschaft plötzlich aufgebrochen und an uns vorbei und ich wollte ja die Gelegenheit gerne nutzen um „zufällig in die gleiche Richtung“ zu gehen und ein bisschen den Leuten zuzuschauen, aber da hat mir M nicht mitgespielt. Da tut man sich vielleicht allein leichter, ein bisschen in den Kontakt zu kommen oder zumindest in der Umgebung eines derartigen Ereignisses seine Kreise zu ziehen. Und ich versteh s eh, dass das schnell einmal ein bisschen herausfordernd wirken kann und rückblickend ist es schwer zu sagen, wem gegenüber ich mich hier provokanter erlebt hab. Wir sind dann zu einem unterirdischen Schnitzelwirten abgebogen.

Ich hab schon ein anderes Gefühl gehabt in den Städten da oben im Norden. Ein bisschen wilder ist es mir erschienen, weniger aufgeräumt, weniger streng. Vielleicht insgesamt etwas weniger von dieser japanischen Kultur, wie ich sie archetypisch zwischen Osaka und Tokio erlebt habe. Japan halt auch nur ein Nationalstaat, in dem von einem kulturellen Zentrum heraus die Peripherie kolonisiert wurde. Sowohl in Hokkaido als auch auf den Inseln im Süden flockt der kulturelle Einfluss halt auch ein bisschen aus: An beiden „Enden“ gibt s eigenständige ethnische Gruppen, die bis heute überlebt haben, die Ainu auf Hokkaido und die Ryukyuan auf den südlichen Inseln um Okinawa. Von den Ainu sind nur wenige übrig, die nicht bereits in die japanische Leitkultur assimiliert wurden. Aber man scheint noch Feste zu feiern und in den U-Bahnstationen gibt es Schmuck mit Ainu Designs zu kaufen.
Abends schauen wir uns ein paar Minuten Rugby in der Fanzone an. Das hat uns beide ein bisschen Überwindung gekostet, aber ich hab letztlich darauf bestanden, wenn wir schon hier sind, wo sich hunderttausende die Finger danach abschlecken. Es war dann besagten Hunderttausenden zum Trotz wenig los in der Fanzone. Und auch im Stadion, hat man uns einmal gesagt. Ich wollte ja tatsächlich einmal Karten kaufen, aber wir hätten die wohl auch einfach vor dem Stadion noch geschenkt bekommen. Man sieht s dann auch auf den großen Schirmen in der Fanzone, dass die Stadien halbleer sind. Aber wir erwischen s ganz gut, mit zwanzig Minuten die Togo noch gegen England durchhalten muss. Das ist gerade genug Zeit für uns, dass wir die Regeln ein bisschen aus dem ableiten können, was vor unseren Augen passiert. Vor allem aber ist es ganz amüsant, ein bisschen zuzuschauen, mit was für einem Körpereinsatz sich diese Spieler ihrem Sport hingeben. Noch dazu in einer Situation wo das Match bereits dermaßen entschieden war. Das kann ich nicht leugnen, dass das eindrucksvoll ist. Aber natürlich ist eine halbe Stunde dann auch schon genug.

Wir sitzen schon wieder im Zug und sind auf dem Weg nach Tokio. M macht einen kleinen Umweg, den mir mein ablaufender Railpass nicht erlaubt, aber ein bisschen freue ich mich ja auch darauf, einen Tag allein im Kaffeehaus zu sitzen. In Tokio treffen wir dann noch D, die gerade aus Seoul auf einen Abstecher nach Tokio kommt. Klar, wenn man schon in der Gegend ist. Und wir laufen ein bisschen zu dritt durch die Stadt, erstes Ziel: Das Café in dem man nicht reden darf. Im Leon haben sie nämlich große Boxen aufgestellt, durch die den ganzen Tag von Schallplatten aus klassische Musik gespielt wird. Dazu gibt s mittelmäßigen Kaffee. Ein schönes Konzept, natürlich. Ich mein, man kann nicht direkt sagen, dass sie da unprätenziös an die Sache herangehen. Aber es ist angenehm in einem unscheinbaren Haus versteckt, es hat eine angenehme Heruntergekommenheit und die paar Leute, die drin sitzen, scheinen mehrheitlich zum Arbeiten hergekommen zu sein. Es wirkt also tatsächlich nicht nur wie das überdrehte Geisteskind einer Anerkennung heischenden Hipsterverbindung. Dass man weniger hierher kommt um, wie (ich glaube) Joseph Roth über die Architektur des Burgtheaters sagt, von den anderen ZuseherInnen gesehen zu werden, wird dadurch verstärkt, dass die Sitzplätze größtenteils in die Richtung der gigantischen Lautsprecher gerichtet sind und man schon deshalb still sitzt, weil jede Bewegung ein Knarzen und Rascheln zur Folge hat. Und der als Deejay doublierende Kellner sagt seine nächste Schallplatte so entschuldigend und zurückhaltend an, dass es das schon einen Besuch wert war. was so die richtige Stimmung ist, um durch die vielen Abteilungen des Geschäfts zu laufen, das nicht Super Hans heißt. Tokyu Hands, das ist es. Da gibt s alles und in jedem zweiten Stock muss sich der eine oder die andere von irgendwas losreißen. Oder auch nicht, auch einkaufen ist erlaubt, warum nicht. Nur in der Kleintierabteilung beschränkt man sich bitte auf fassungsloses Starren.

Das war s dann auch fast schon wieder. Weil ich bin in Tokio dann tatsächlich mehr im Kaffeehaus gesessen und in der unmittelbaren Nachbarschaft des Hostels abgehangen. Das war eine angenehme Abwechslung im Gegenzug zur Überforderung, mit der mir Tokio ja doch ab und zu zugesetzt hat. Und wiederum: es ist schon auch eine Leistung, wie es in der Stadt gelingt, dass neben einem vollkommen überdrehten, touristisch überanspruchtem Viertel, nicht nur tote, ausgelaugte Gegend liegt, sondern sympathische Nachbarschaften, mit ihren eigenen kleinen Straßenlokalen, in denen schon wieder kaum jemand Englisch spricht. Ich verbringe meinen interessantesten Nachmittag allerdings in einem Kaffee, in dem sie durchaus Englisch sprechen. Es ist mal wieder so etwas, wo man mir einen Platz an der Bar anbietet und ich sitze dann neben einer, die gerade ihre Schicht vorbei hatte und wir plaudern die nächsten vier Kaffee (in vielen der Cafés, die Single Origin Kaffees zubereiten, kriegt man die zweite Tasse desselben Kaffees für kaum die Hälfte der ersten…) über Kaffee, über das Café, über Japanisch, über Japan und die Welt.
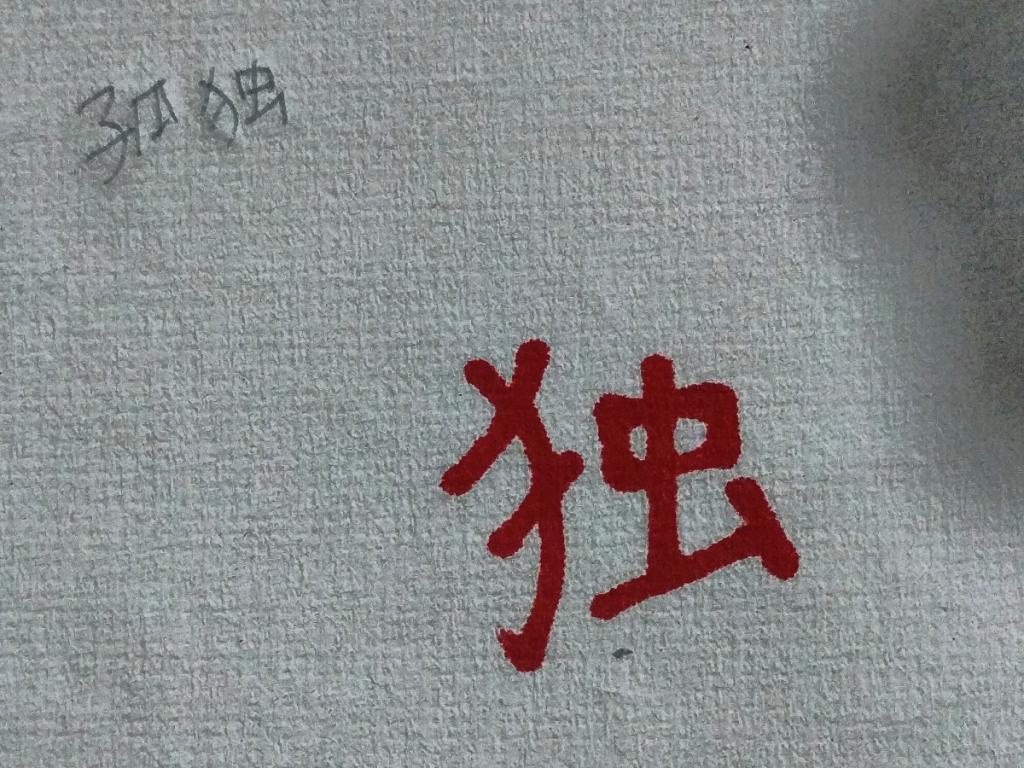
Und das ist eigentlich die schönste Erinnerung, die ich aus Japan mitgenommen habe: wie schön ich oft mit JapanerInnen ins Gespräch gekommen bin, meistens über ein Essen oder halt einen Kaffee. Aber dass der Zugang irgendwie so schnell da war und das Interesse und die Lust am Plaudern und dass das alles nur sehr wenig eingeschränkt war von irgendwelchen Vorannahmen über wie man sich zu verhalten hätte. Wenn ich Japan insgesamt immer wieder als das erlebt habe, als eine Gesellschaft, die ihren BürgerInnen viele Vorgaben macht, wie man sich im Alltag zu verhalten habe, wo man jeden Tag tausenden uniformierten Salary-Men gegenübersteht, den Angestellten, die tagsüber durch die Straßen hetzen, abends in der U-Bahn an ihren Telefonen hängen oder des nachts betrunken aus einem Isakaya herausstolpern, hab ich gleichzeitig nirgendwo so schnell freundschaftliche Kontakte geknüpft, wie in Japan. Und jetzt war diese Barista, mit der ich in Tokio zuletzt noch geplaudert hab, dann sogar noch kritisch gegenüber Japan. Nämlich über das politische Desinteresse der JapanerInnen oder zumindest ihrer Generation oder halt auf jeden Fall über ihr eigenes, da ist sie schon unzufrieden gewesen, das sagen zu müssen. Und dass ihr Gefühl sei, dass sich Japan so blind gegenüber der Welt verhalte, dass insbesondere China einfach bewusst ignoriert werde. Stattdessen gebe es halt nur Europa und Amerika, dorthin blicke man. Aber den Stolz auf Japan, das war trotzdem da: Als ich gesagt habe, dass ich auf mein Heimatland einfach nicht stolz bin, da war sie schon ein bisschen erstaunt, quasi: wie das sein könne. Nun, hab ich gesagt, es sei vielleicht eher, dass auf Dinge, auf die ich in meinem Heimatland stolz wäre, mein offizielles Heimatland einfach nicht stolz ist. Aber das ist natürlich kryptisch und ich glaube, ich hab s einfach dabei belassen, dass mir da kaum etwas dazu einfalle, auf das ich stolz sein würde.
Zweimal haben wir unseren Abflug nach Korea vor uns hergeschoben, es war uns dann immer ein bisschen zu kurzfristig, zwei Tage vorher zu buchen. Aber wir haben s dann geschafft, gleichzeitig zu verlängern und zu buchen, und uns selbst so ein Schnippchen geschlagen.